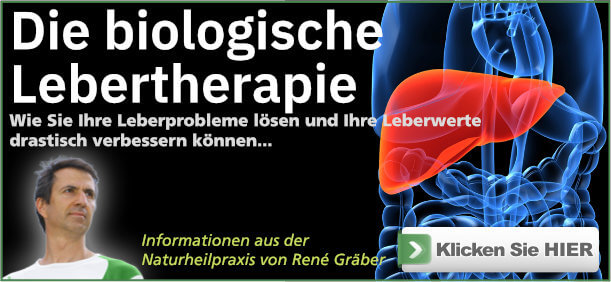Die Leberenzyme – auch nur eine Definitionssache
Lebererkrankungen anhand von Laborwerten zu ermitteln scheint nicht leicht zu sein. Immer wieder stoßen wir auf die Hinweise, dass erhöhte Werte für diesen oder jenen Parameter bestenfalls Hinweise, nicht aber Beweise für eine Lebererkrankung sind.
Immer wieder wird Patienten mitgeteilt, dass weitere Parameter erhoben werden müssen, um mehr Klarheit zu bekommen beziehungsweise bestimmte Erkrankungen auszuschließen.
Zum Beispiel die alkalische Phosphatase (=aP), die als der sensibelste Parameter für eine Cholestase gilt (siehe auch mein Beitrag zu Cholestaseparameter). Aber eine erhöhte aP alleine ist noch kein Beweis für eine Cholestase.
Erst im Zusammenspiel mit zum Beispiel einer erhöhten Gamma-GT und/oder LAP (Leucin-Amino-Peptidase) gibt es den höchst wahrscheinlichen Hinweis auf eine Erkrankung, die für die Cholestase verantwortlich sein könnte. Aber auch hier können immer noch keine definitiven Aussagen über die Natur der möglichen Erkrankung gemacht werden.
Grund für dieses „lustige Krankheitsraten“ ist die Tatsache, dass oft Enzymsysteme in ihrer Gesamtheit gemessen werden und keine spezifisch in der Leber vorkommenden Enzyme. Das gilt vor allem für ASAT und ALAT, für die es so, wie sie gemessen werden, keine „Leberspezifität“ gibt.
Sind die Werte erhöht, dann kann man zu einem gewissen Wahrscheinlichkeitsgrad davon ausgehen, dass die Erhöhung auf eine Leberschädigung zurückzuführen ist – so die Vermutung. Solche Verfahren sind natürlich weit von exakten wissenschaftlichen Methoden entfernt.
Denn wenn hier die Werte eines Patienten in einem Bereich liegen, der laut Lehrbuch als Normbereich definiert ist, dann ist der Patient leider nur „höchst wahrscheinlich“, nicht aber „ganz sicher gesund“.
Umgekehrt: Liegen die Werte über dem angenommenen Normbereich, dann ist mit hoher Wahrscheinlichkeit der Patient erkrankt. Bei einigen Enzymsystemen können zum Beispiel Kinder und Schwangere chronisch erhöhte Werte haben (zum Beispiel bei den alkalischen Phosphatasen), ohne dabei als krank zu gelten.
Daher stellt sich die Frage, wenn ich Untersuchungsmethoden einsetze (um Werte zu erhalten), die jedoch keine absolute Gültigkeit haben, wie komme ich dann zu „Normwerten“?
In der Naturwissenschaft gibt es in der Regel festgelegte Eckdaten, die überall gelten, wie zum Beispiel die Anziehungskraft der Erde. Abweichungen sind erklärbar als Resultat von Beschleunigungen und / oder Veränderungen von Masse.
In der Schulmedizin und der an sie angeschlossenen Labordiagnostik ist das aber anders: Basis der Normwerte (Eckdaten) für die Labordiagnostik im Allgemeinen (also nicht nur für die Leberwerte), ist der Zustand der untersuchten Bevölkerung.
Wenn 95 Prozent der Bevölkerung einen gewissen Bereich aufweisen, dann wird das als Normbereich definiert. Natürlich ist das stark vereinfacht was ich jetzt beschreibe, am im Prinzip ist es genau so.
Wenn wir also ein Volk von Säufern auf Leberenzyme untersuchen würden (als etwas überzogenes Beispiel), dann hätten wir es mit Gamma-GT-Werten zu tun, die für zum Beispiel asiatischen Bevölkerungsgruppen als extrem krankhaft gelten würden. Bei der Ermittlung des europäischen beziehungsweise deutschen Normbereichs für Leberenzyme sind natürlich die offensichtlich Leberkranken nicht mit in die Auswertung genommen worden.
Aber der Ausschluss der Leberkranken bedeutet auch nicht eine signifikante Schmälerung des zu bewertenden Bevölkerungspools.
In dieser Bewertung eingeschlossen sind mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit eine signifikante Anzahl an Individuen, die einen mehr oder weniger riskanten Lebensstil pflegen, der die Normgrenzen in die Höhe treibt. Ergo: Normal ist relativ und abhängig, wann und wo ich wen untersuche und für „normal“ erkläre. Das Ganze klingt nur wenig evidenzbasiert und hat auch nichts damit zu tun.
Wie wenig evident diese Angelegenheit ist, zeigt das Beispiel Gamma-GT-Werte bei Frauen und Männern. Der Normwert für Frauen liegt bei 42 U/l, der bei Männern ist 60 U/l. Das sind 50 Prozent mehr als bei Frauen, was statistisch gesehen nach einer statistischen Signifikanz aussieht.
Welche biologischen oder sonst wie Unterschiede gibt es denn jetzt, die einen solchen krassen Unterschied als normal rechtfertigen? Ich kenne jedenfalls keinen. Es gibt nur mehr Männer, die mehr Alkohol trinken als Frauen, was für diese Gruppe einen erhöhten Gamma-GT-Spiegel bewirkt.
Und dieser alkoholbedingte Mehr-Wert ist die Basis für die Normierung seitens der evidenzbasierten schulmedizinischen „Wissenschaft“. Denn Männer, die keinen Alkohol trinken, aus welchem Grund auch immer, zeigen im Vergleich zu Frauen keinen signifikanten Unterschied in den Gamma-GT-Werten.
Wenn Sie eine andere physiologische Erklärung kennen: bitte schreiben Sie mir! Meine Kontaktdaten finden Sie HIER.
Patienten krank und gesund definiert
Würde man bei der Ermittlung von Normwerten auf Menschen zurückgreifen, die kein Übergewicht zeigen und kein (oder kaum) Alkohol trinken (was einer natürlicheren Lebensweise entsprechen würde), dann lägen die heutigen Normbereiche vergleichsweise so hoch, dass man sie schon als behandlungsbedürftig ansehen müsste. Für die Leberwerte heißt das, dass die meisten modernen Menschen bereits Leberschädigungen mit sich tragen, die aber von der Schulmedizin als normal angesehen werden.
Und der „Schulmediziner“ schließt daher messerscharf, dass nicht sein kann, was nicht sein darf – und schon werden aus erhöhten, potentiell pathologischen Leberwerten ganz normale, unbedenkliche Werte. Immerhin ist Deutschland das Land der Dichter und Denker.
Und, nicht zu vergessen, das Land mit den meisten Biersorten (über 2000 verschiedene Marken) auf der ganzen Welt. Hier gilt es einen Ruf zu verteidigen. Eine ganze Industrie lebt davon, die durch pathologische Normwerte in arge Bedrängnis geraten würde.
Wie man sieht, geht es auch anders herum. Während die Schulmedizin bei den Cholesterinwerten die Normgrenze von 250 mg/dl auf 200 nach unten setzt und somit Millionen neue Cholesterinsenker-Kunden produziert (zum Wohle der Pharmaindustrie), sorgt der umgekehrte Weg bei den Leberenzymen für das Wohl der Alkoholindustrie – ganz wie es einem gefällt.
Während man dem bösen Cholesterin die übelsten Wirkungen bescheinigt, einer natürlich vorkommenden Substanz wohlgemerkt, die der Organismus auch noch selbst herstellt, sieht man bei einer nicht organischen Substanz, wie dem Alkohol, keinen Grund, ebenso forsch auf seine üblen Folgen aufmerksam zu machen und die Normwerte nach unten zu berichtigen.
Ich persönlich glaube nicht, dass Cholesterin eine gefäßschädigende Substanz ist. Ich glaube aber, dass Alkohol wesentlich ungünstigere Effekte auf den menschlichen Organismus hat als Cholesterin.
Die Normwerte für Cholesterin und für die Leberwerte sind gleichermaßen das Ergebnis von nicht wissenschaftlich durchgeführten Untersuchungen, bei denen es unter dem Strich genug Platz gab für Manipulationen und interessierte Verdrehungen von Ergebnissen.
Beitragsbild: iStock
Übrigens: Wenn Sie solche Informationen interessieren, dann fordern Sie unbedingt meinen kostenlosen Praxis-Newsletter „Unabhängig. Natürlich. Klare Kante.“ dazu an: