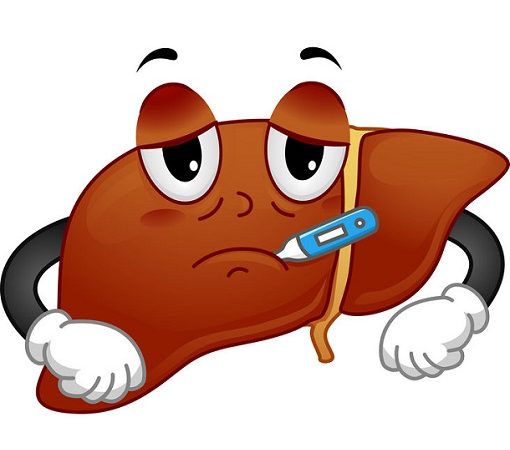Kategorie Allgemein
Leberreinigung: So befreien Sie Ihre Leber von Giften und fühlen sich besser!
Die Leber ist die zentrale Drehscheibe unseres Stoffwechsels. Funktioniert sie nicht mehr optimal, macht sich das sofort bemerkbar: Wir fühlen uns schlapp, müde und unkonzentriert. Eine Leberreinigung kann Abhilfe schaffen In der Leber werden Fette, Kohlenhydrate und Eiweiße aufbereitet und zum Teil gespeichert. Für diese Schwerstarbeit ist ein intensiver Kontakt mit dem Kreislauf erforderlich. Täglich …
Weiterlesen „Leberreinigung: So befreien Sie Ihre Leber von Giften und fühlen sich besser!“ »
Wann normalisieren sich die Blutwerte nach Alkohol?
Die Normalisierung der Blutwerte nach Alkoholkonsum kann variieren, abhängig von mehreren Faktoren wie der Menge des konsumierten Alkohols, der Geschwindigkeit des Konsums, Ihrem Körpergewicht, Ihrer Gesundheit, und wie häufig Sie trinken. Hierzu müssen wir zwei „Zustände“ betrachten: einmal den akuten Zustand (nach Alkohol) und den chronischen Zustand, wenn z.B. bereits Leberwerte erhöht sind. Akuter Zustand …
Weiterlesen „Wann normalisieren sich die Blutwerte nach Alkohol?“ »
Jeden Tag 1 Flasche Wein – Normal? Was sagen die Leberwerte?
Kommen wir erst einmal zur Frage was „Normal“ sein sollte oder ist. Die Frage nach der „normalen“ oder sicheren Menge an Wein, die man trinken darf, variiert je nach den Richtlinien verschiedener Gesundheitsorganisationen und kann von Faktoren wie Alter, Geschlecht und allgemeinem Gesundheitszustand abhängen. Generell raten viele Gesundheitsexperten dazu, einen moderaten Alkoholkonsum nicht zu überschreiten, …
Weiterlesen „Jeden Tag 1 Flasche Wein – Normal? Was sagen die Leberwerte?“ »
Gute Leberwerte trotz Alkohol? Ist das möglich?
Einfache Antwort: Ja. Es kommt natürlich auf einige Faktoren an. Und so ist es möglich, dass einige Menschen trotz regelmäßigen Alkoholkonsums normale Leberwerte aufweisen. Dies kann durch verschiedene Faktoren bedingt sein, darunter die genetische Veranlagung, das Ausmaß des Alkoholkonsums, den allgemeinen Gesundheitszustand und Lebensstilfaktoren wie Ernährung und Bewegung. ABER: „Normale Leberwerte“ bedeuten nicht unbedingt, dass …
Weiterlesen „Gute Leberwerte trotz Alkohol? Ist das möglich?“ »
Die Bedeutung der Transaminasen (Aminotransferasen)
Transaminasen werden auch Aminotransferasen genannt. Wie der Name schon vermuten lässt, handelt es sich hier um Enzyme, die praktisch in allen Lebewesen zu finden sind. Aufgaben der Transaminasen Sie übertragen α-Aminogruppen von einem Donormolekül auf ein anderes Molekül (Akzeptormolekül). Ohne die Transaminasen ist der Aminosäurestoffwechsel nicht denkbar. Wenn wir von einem Donormolekül sprechen, dann ist …
Weiterlesen „Die Bedeutung der Transaminasen (Aminotransferasen)“ »
Schilddrüse und Leber – eine innige Wechselbeziehung
Die Leber ist bekannt dafür, dass sie bei Alkoholikern nicht mehr im besten Zustand sein kann, denn Alkohol ist ein Gift, welches die Leberzellen zerstört. Aber dabei soll es nicht bleiben. Denn es gibt noch mehr Probleme, mit denen sich die Leber auseinanderzusetzen haben kann: Die Leber | Funktion – Leberprobleme – Leberkrankheiten. Vielleicht ist …
Weiterlesen „Schilddrüse und Leber – eine innige Wechselbeziehung“ »
Die Leberwerte im Zusammenhang mit der MP Untersuchung
MPU oder „medizinisch psychologische Untersuchung“ – hier handelt es sich um einen Test, der die Fahreignung eines „Antragstellers“ beurteilen soll. Ziel der Selektion durch die MPU ist das Eliminieren von potentiellen Verkehrsrowdies und damit eine Senkung der Verkehrsunfälle. Beim „gemeinen Volk“ wird dieser Test meist immer noch als „Idiotentest“ bezeichnet. Der brave Beamte hat für diesen Test …
Weiterlesen „Die Leberwerte im Zusammenhang mit der MP Untersuchung“ »
Der Leberstoffwechsel
Die Leber ist nicht nur die größte Drüse des Organismus, sondern gleichzeitig das zentrale Organ für den gesamten Stoffwechsel. Die Leber baut sich aus zwei großen Leberlappen auf. Der rechte Lappen ist größer als der linke und liegt unter dem Zwerchfell, mit dem er teilweise verwachsen ist. Der linke Lappen reicht bis in den Oberbauch …
Die Leberschwäche
Leberschwäche oder Leberinsuffizienz ist eine Funktionsstörung der Leber, bei der die Stoffwechselaufgaben des Organs teilweise oder sogar komplett ausfallen. Ein Totalausfall entspricht dem Leberversagen, der extremsten Form der Leberinsuffizienz. Es ist fast überflüssig, zu betonen, dass ein Leberversagen ein akut lebensbedrohlicher Zustand ist. Dabei kommt es zu einem typischen „Dreierpack“ in Sachen Symptomatik: Zuerst Ikterus …
Die Leberenzyme – auch nur eine Definitionssache
Lebererkrankungen anhand von Laborwerten zu ermitteln scheint nicht leicht zu sein. Immer wieder stoßen wir auf die Hinweise, dass erhöhte Werte für diesen oder jenen Parameter bestenfalls Hinweise, nicht aber Beweise für eine Lebererkrankung sind. Immer wieder wird Patienten mitgeteilt, dass weitere Parameter erhoben werden müssen, um mehr Klarheit zu bekommen beziehungsweise bestimmte Erkrankungen auszuschließen. …
Weiterlesen „Die Leberenzyme – auch nur eine Definitionssache“ »