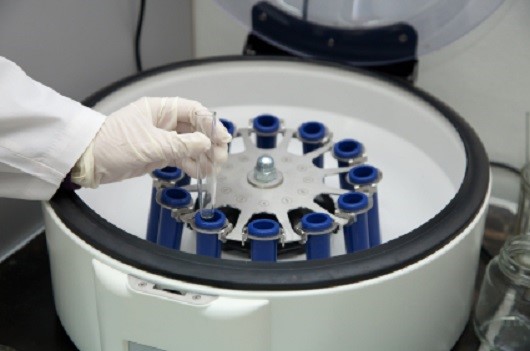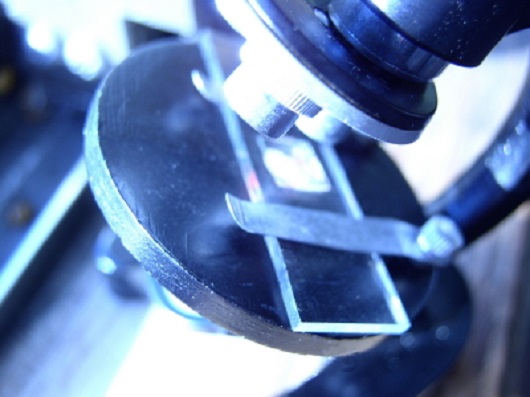Kategorie Leberwerte
Triglyceride Werte – Bedeutung
Triglyceride wurden früher „Neutralfette“ genannt. Chemisch gesehen sind sie dreifache Ester des Glycerins (ein Alkohol) mit drei Säuremolekülen. Daher werden sie in der (besonders) wissenschaftlichen Sprache als „Triacylglycerole“ (TAGs) bezeichnet. Triglyceride haben also drei Fettsäurereste, die unterschiedlich lang und geformt sein können. Daher gibt es eine schier unendliche Vielfalt bei den Triglyceriden, die labortechnisch nur …
Pro-Kollagen-III-Peptid
Das Pro-Kollagen-III-Peptid ist ein Blutwert, ein sogenannter „Marker“ um den Zustand der Leber zu bestimmen – und zwar im wesentlichen den Bindegewebsanteil. Somit dient das Pro-Kollagen-III-Peptid im Wesentlichen dazu den Verlauf einer chronischen Lebererkrankung zu dokumentieren. Bei dem Marker Pro-Kollagen-III-Peptid geht es als um das Bindegwebe in der Leber. Und wenn dieses zu viel wird, haben …
Hämoglobinwerte bei Leberproblemen
Hämoglobinwerte können bei Personen mit Leberproblemen variieren, je nach Art und Schweregrad der Lebererkrankung sowie weiteren individuellen Faktoren. Die Leber spielt eine zentrale Rolle bei der Produktion verschiedener Proteine, einschließlich derer, die am Blutgerinnungsprozess beteiligt sind, und hat auch Einfluss auf die Aufnahme und Speicherung von Eisen, was wiederum für die Produktion von Hämoglobin wesentlich …
Die Glutamatdehydrogenase (GDH) im Zusammenhang mit Lebererkrankungen
Bei der Glutamatdehydrogenase haben wir es (wieder einmal), mit einem Enzymsystem zu tun, das in diesem Fall Glutamat, Wasser und NAD(P)+ zu Ammonium, α-Ketoglutarat und NAD(P)H katalysiert. Die rückläufige Reaktion wird ebenfalls von der Glutamatdehydrogenase gesteuert. Es wurde allerdings lange angenommen, dass die rückläufige Reaktion bei Säugetieren und Mensch nur eine rein theoretische Option ist. …
Weiterlesen „Die Glutamatdehydrogenase (GDH) im Zusammenhang mit Lebererkrankungen“ »
Die Gamma-Glutamyltransferase: Normalwerte und die Bedeutung von Abweichungen
Eine weitere „Leber-Transaminase“ ist die Gamma-GT, was für Gamma-Glutamyltransferase, auch Gamma-Glutamyltranspeptidase steht. Das Gamma steht für Gamma. Deswegen wird das ganze auch Gamma GT gesprochen. Letztlich sind das alles Bezeichnungen für ein und dasselbe Enzym. Wenn Sie im Internet nach diesem Wert suchen, ist die Wahrscheinlichkeit hoch, dass Sie wissen möchten, warum oder wann der …
Weiterlesen „Die Gamma-Glutamyltransferase: Normalwerte und die Bedeutung von Abweichungen“ »
Gründe für abweichende Ferritinwerte
Ferrum ist das lateinische Wort für Eisen. Daher ist es naheliegend, dass das Wort „Ferritin“ auch etwas mit Eisen zu tun hat. Dabei handelt es sich um einen Proteinkomplex, der praktisch im gesamten Reich lebender Organismen vorkommt. Dieser Proteinkomplex ist ein Speicherkomplex für Eisen bei Tieren, Pflanzen und sogar Bakterien. Beim Menschen ist das Ferritin …
Bilirubin – Gallenfarbstoff
Im Zusammenhang mit der Leber und Lebererkrankungen bietet das Bilirubin allerdings leider „Hinweise“. Es gilt auch nicht als klassischer „Leberwert“. Bilirubin – der Name geht auf „bilis“ (lateinisch) die Galle und „ruber“ rot zurück. Der Bezug zur Galle stimmt zwar, aber Bilirubin hat mit der Farbe rot nur wenig zu tun. Gelb ist hier eher angesagt. …
Die Aspartat-Aminotransferase (ASAT / GOT) – Bedeutung und Gründe für erhöhte Werte
Früher nannte man dieses Enzymsystem GOT für Glutamat-Oxalacetat-Transaminase. Heute wird es als AST, ASAT oder AAT bezeichnet, was für Aspartat-Aminotransferase steht. Wichtig ist die genaue Kenntnis des Namens eigentlich nicht. Aber man sollte wissen, dass GOT und ASAT das Gleiche bedeuten. Aufgabe des ASAT Dieses Enzymsystem hat die Aufgabe, α-Ketoglutarat zu Glutaminsäure umzuwandeln. Diese Funktion …
Weiterlesen „Die Aspartat-Aminotransferase (ASAT / GOT) – Bedeutung und Gründe für erhöhte Werte“ »
Die Alanin-Aminotransferase (ALAT / GPT) – Bedeutung und Gründe für erhöhte Werte
Die Alanin-Aminotransferase wird meist mit ALAT oder ALT abgekürzt. Selten findet man noch die Abkürzung GPT (=Glutamat-Pyruvat-Transaminase) – eine frühere, nicht mehr gebräuchliche Bezeichnung. Es handelt sich hier um ein Enzymsystem, das fast ausschließlich in der Leber vorkommt. Für sein Funktionieren wird als Coenzym das Vitamin B6 benötigt. Die Aufgabe des ALAT (GPT) Die Aufgabe …
Weiterlesen „Die Alanin-Aminotransferase (ALAT / GPT) – Bedeutung und Gründe für erhöhte Werte“ »
Das „Problem“ Alkohol im Zusammenhang mit den Leberwerten
Wie ich im Beitrag „Die Rolle des Ammoniaks bei den Lebererkrankungen“, ist ein chronisch erhöhter Alkoholkonsum für ungefähr die Hälfte aller Leberzirrhosen verantwortlich. Die Fruktose (der Fruchtzucker) wird als Problem überhaupt nicht erwähnt, was ich als unverständlich ansehe, aufgrund der sehr ähnlich ablaufenden biochemischen Vorgänge bei der Entgiftung von Fruktose und Alkohol durch die Leber. Man kann …
Weiterlesen „Das „Problem“ Alkohol im Zusammenhang mit den Leberwerten“ »