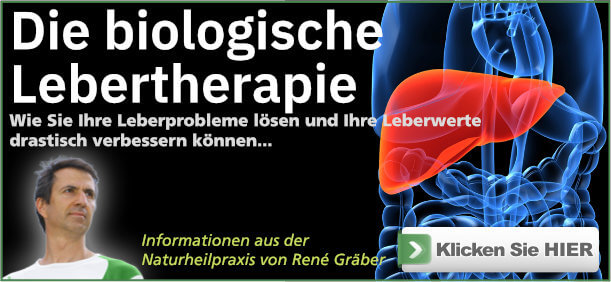„Schlechte“ Leberwerte sind meistens Zufallsbefunde bei Routine-Laboruntersuchungen. In einem Viertel der Fälle sind einer oder mehrere Leberwerte erhöht, ohne dass eine Erkrankung vorliegt. Es sind deshalb immer weitere Untersuchungen nötig. Die Abklärung ist vor allem wichtig, um eine schwere Krankheit wie Leberkrebs oder Leberzirrhose auszuschließen.
Von großer Bedeutung ist eine vollständige Anamnese, die eine ganze Reihe von Faktoren abfragt:
- Welche Medikamente (auch pflanzliche Heilmittel) wurden im zeitlichen Zusammenhang mit der Werterhöhung eingenommen?
- Gab es Bluttransfusionen?
- Hat sich der Patient tätowieren lassen?
- Gab es Kontakt mit Gelbsuchtpatienten?
- Besteht ein Alkohol- oder Drogenmissbrauch?
- Ist der Patient ohne ausreichenden Schutz sexuell aktiv?
- Treten Begleitsymptome wie Muskel- und Gelenkschmerzen, Ausschläge, Gewichtsverlust, Übelkeit, Bauchschmerzen, Fieber oder veränderte Ausscheidungen auf?
Diese und weitere Fragen sowie eine körperliche Untersuchung des Patienten bringt meist schon mehr Aufschluss über die erhöhten Werte. Häufig sind außerdem weitere Messungen in den nächsten Monaten notwendig, um die Entwicklung zu beobachten.
Die häufigste Ursache für erhöhte Leberwerte ist Alkoholmissbrauch. Gleichzeitig wird dieses Problem aber sehr oft verschwiegen und heruntergespielt, woran die medizinische Praxis sogar einen gewissen Anteil hat. So ist der noch tolerable Normwert für Gamma-GT für Männer etwas höher definiert als für Frauen.
Doch jeder Arzt weiß, dass dies am Trinkverhalten der Männer liegt. Die Referenz-Bereiche für die Laborwerte werden bei Menschen ermittelt, die idealerweise völlig gesund sein sollen, aber es eben nicht immer sind.
Und dadurch ergibt sich bei Männern eben ein höherer Durchschnitt für den Gamma-GT. Indirekt wird damit von der medizinischen Wissenschaft der Alkoholabusus bei Männern ein Stück weit toleriert.
Auch viele Medikamente können zu erhöhten Leberwerten führen, zum Beispiel Schmerzmittel, Antibiotika, Antiepileptika oder Lipidsenker. Auch ungesundes Essen kann die Leberwerte erhöhen, weil die Leber nach andauernder starker Belastung Verfettungen ausbildet.
Weitere mögliche Ursachen sind Infektionen mit Parasiten, Bakterien und Viren sowie im schlimmsten Fall eine Leberzirrhose oder Leberkrebs. Außerdem können erhöhte Leberwerte auf Erkrankungen der Gallenwege hinweisen.
In einigen Beiträgen dieses Leberwerte-Lexikons hatte ich es ja bereits angedeutet: „Schlechte Leberwerte“ im eigentlichen Sinne gibt es nicht.
Zu hohe oder, vereinfacht ausgedrückt, schlechte Leberwerte beziehen sich oft auf die gängigen, im Labor durchgeführten Untersuchungen. Und das sind in der Regel ASAT, ALAT und Gamma-GT. Aber auch die anderen, weniger gebräuchlichen Bestimmungen sind keine Garantie für eine „eindeutige“ Diagnose.
Und für die Ursachenbestimmung eignet sich eigentlich keiner der benutzten Werte. Von daher werden fast immer mehrere Systeme zusammen bestimmt, um zu einem einigermaßen klaren Bild in der Diagnose zu kommen.
Aber selbst das bringt oft keine definitive Diagnose einer Erkrankung:
- GOT (ASAT) – Normalwert 52 U/l.
Kommt in Leber sowie in der Skelett- und Herzmuskulatur vor. Ist erhöht bei Verletzungen der Muskulatur, Herzinfarkt und Leberproblemen. In falsch gelagerten Blutproben setzen lysierende Erythrozyten ASAT frei, was zu falsch erhöhten Laborwerten führt. Bei der Einnahme von Alkohol und einer Reihe von Medikamenten steigt das ASAT schnell an. - GPT (ALAT) – Normalwert 50 U/l.
Kommt fast nur in der Leber vor. Wird oft mit ASAT bestimmt, um spezifischere Aussagen treffen zu können, zum Beispiel, ob ein Alkoholproblem beim untersuchten Patienten vorliegen könnte. ALAT ist leicht erhöht bei Leberverfettung, Lebertumoren, Lebermetastasen, Cholangitis etc.
Stark erhöhte Werte bei Hepatitis, Leberzirrhose, Stauleber, toxischer Belastung der Leber wie Pilzvergiftung. Bei Herzinfarkt ebenfalls kurzfristig erhöht. - Gamma-GT – Normbereich Männer: 60 U/l; Frauen 42 U/l.
Gamma-GT ist der empfindlichste Markerwert, um Störungen der Leber und der Gallengänge zu erkennen. Erhöhung deutet auf Leberschäden hin, wobei die Ursache nicht erkennbar ist. Alkoholabusus, Leberzirrhose, Lebermetastasen, chronische Hepatitis, toxische Ereignisse und Medikamente führen zur Erhöhung der γ-GT-Spiegel. Besonders hohe Werte bei Cholangitis, Cholestase, akuter Hepatitis und toxischen Leberschäden. - Bilirubin – Normalbereich unter 1,2 mg/dl.
Zu viel Bilirubin im Blut führt zu Einlagerungen in die Haut und Sclera der Augen. Resultat ist die Gelbsucht. Zu hohes indirektes Bilirubin deutet auf einen verstärkten Blutabbau hin. Zu hohes direktes Bilirubin deutet auf eine Störung der Ausscheidung von Bilirubin hin. Ursache hierfür ist oft eine Cholestase. Veränderte Bilirubinwerte können aber auch ein Zeichen für das Rotor-Syndrom oder das Dubin-Johnson-Syndrom sein. Beides sind seltene angeborene Krankheiten ohne große Beeinträchtigung. - Ferritin – hier gibt es unterschiedliche Normwerte, die von Alter und Geschlecht abhängig sind. Diese liegen zwischen 7 und 270 Nanogramm pro Milliliter.
Bei Werten unter Normal kann ein Eisenmangel vorliegen. Andere Ursachen: Hypothyreose, Vitamin-C-Mangel, Infektionen, Hepatitis, Leberkrebs, Leberzirrhose oder Zöliakie. Liegen die Werte über Normal, kann eine Entzündung vorliegen. Weitere mögliche Ursachen: Hämochromatose, Akutreaktion auf Erkrankungen, Autoimmunerkrankungen, Krebserkrankungen und Hungerzustände. - Hämoglobin – Normwerte abhängig von Alter und Geschlecht zwischen 10,5 und 17,5 g/dl.
Zu geringe Werte deuten auf folgende mögliche Ursachen: Blutverlust, mangelhafte Ernährung, Probleme mit dem Knochenmark, Chemotherapie, Nierenversagen, genetische Fehlkonstellationen wie zum Beispiel bei der Sichelzell-Anämie oder Thalassämie.
Zu hohe Werte haben nur wenige mögliche Ursachen: Langer Aufenthalt in großen Höhen (Bergsteiger), Rauchen, Dehydrierung und Tumore. Für die Bewertung von Leberproblemen hat Hämoglobin kaum eine Bedeutung. - Cholestaseparameter – Diese ist kein eigenständiger Wert, sondern ein Bündel von Werten, die durch eine Cholestase erhöht werden.
Dabei handelt es sich um Bilirubin im Blut und Urin, eine Reihe von Enzymen, Cholesterin, Phospholipide, Gallensäure im Serum, Lipoprotein X und so weiter. - Triglyceride – Normwert unter 151 mg/dl. Keinen direkten Bezug zu Lebererkrankungen.
- Cholesterin – Normwert festgelegt bei 200 mg/dl.
Bei erhöhten Werten können eine Hepatitis oder ein Gallenstau die Ursache sein. Ansonsten gibt es keine direkten Bezüge zu Lebererkrankungen. - Glutamatdehydrogenase – Normwert für Männer 7 U/I, für Frauen 5 U/I.
Erhöhte Werte deuten auf Gallenstau, Hepatitis, Leberkrebs, toxische Ereignisse, Hypoxien, Leberzirrhose, akute virale Hepatitis, Fettleber und so weiter hin. Erhöhte Werte deuten fast immer auf eine Nekrose (Zelluntergang) in der Leber hin.
Beitragsbild: iStock
Übrigens: Wenn Sie solche Informationen interessieren, dann fordern Sie unbedingt meinen kostenlosen Praxis-Newsletter „Unabhängig. Natürlich. Klare Kante.“ dazu an: