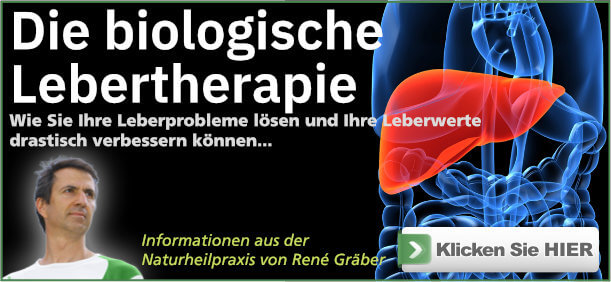Omega-3-Fettsäuren bei Leberproblemen?
Omega-3-Fettsäuren, besonders bekannt für ihre entzündungshemmenden Eigenschaften und können bei Leberproblemen eine unterstützende Rolle spielen.
Wo kommen diese Omega-3-Fettsäuren vor?
Sie sind in verschiedenen Formen wie Eicosapentaensäure (EPA) und Docosahexaensäure (DHA) vorhanden, die vorwiegend in fettem Fisch, wie Lachs, Makrele und Hering, sowie in Fischöl-Ergänzungsmitteln zu finden sind.
In meinem Grundsatzbeitrag zum Omega 3 gehe ich umfassend auf die Thematik ein: Omega-3-Fettsäuren: Wirkung und Kauf-Tipps (vitalstoffmedizin.com)
Bei bestimmten Lebererkrankungen wie der nicht-alkoholischen Fettlebererkrankung (NAFLD) und ihrer schwereren Form, der nicht-alkoholischen Steatohepatitis (NASH), können Omega-3-Fettsäuren potenziell positive Effekte haben. Studien legen nahe, dass Omega-3-Fettsäuren dabei helfen können, den Fettgehalt in der Leber zu reduzieren, Entzündungen zu verringern und den Cholesterinspiegel zu verbessern:
Studienlage
Die Forschung zu Omega-3-Fettsäuren und deren Einfluss auf Lebererkrankungen, insbesondere nicht-alkoholische Fettlebererkrankungen (NAFLD) und nicht-alkoholische Steatohepatitis (NASH), umfasst zahlreiche Studien, die vielversprechende Ergebnisse gezeigt haben.
- Reduzierung des Leberfetts: Einige Studien haben herausgefunden, dass die Einnahme von Omega-3-Ergänzungen den Fettgehalt in der Leber von Personen mit NAFLD signifikant reduzieren kann. Eine Meta-Analyse, die in der Zeitschrift „Hepatology“ veröffentlicht wurde, zeigte, dass Omega-3-Fettsäuren effektiv den Leberfettgehalt verringern können.
- Entzündungshemmung: Omega-3-Fettsäuren sind für ihre entzündungshemmenden Eigenschaften bekannt. Forschungen deuten darauf hin, dass sie bei Personen mit NAFLD oder NASH helfen können, Entzündungsmarker zu senken.
- Verbesserung der Blutfettwerte: Eine gesunde Leberfunktion ist entscheidend für die Regulierung des Cholesterinspiegels im Körper. Omega-3-Fettsäuren können nicht nur die Lebergesundheit unterstützen, sondern auch direkt dazu beitragen, das LDL-Cholesterin („schlechtes“ Cholesterin) zu senken und das HDL-Cholesterin („gutes“ Cholesterin) zu erhöhen.
Jedoch ist es wichtig zu betonen, dass Omega-3-Fettsäuren nicht als alleinige Behandlung für Lebererkrankungen angesehen werden sollten. Die beste Herangehensweise zur Unterstützung der Lebergesundheit ist eine umfassende, die eine „gesunde Ernährung“ umfasst.
Ideen zur Behandlung (zum Beispiel einer Fettleber) finden Sie in meinem Grundsatzbeitrag: Fettleber: Ursachen und Therapien (naturheilt.com)
Fazit und Praxiserfahrungen
Die Omega-3-Fettsäuren sind auch in der Schulmedizin zwischenzeitlich „salonfähig“ geworden. Grund dafür ist das Interesse der Wissenschaft an dieser Substanz, welches bislang eine Reihe von überzeugenden Resultaten zu dieser Substanz hat bringen können, so dass man gar nicht mehr an ihr vorbeischauen kann.
Aus der Praxis: Autoimmunerkrankungen der Leber und Entzündungen der Leber können durch den Einsatz von Omega-3-Fettsäuren günstig beeinflusst werden. Denn es gibt keinen Grund, anzunehmen, dass Entzündungen der Leber nicht durch das entzündungshemmende Potential der Omega-3-Fettsäuren positiv beeinflusst werden könnten. Gleiches gilt auch für die Autoimmunerkrankungen der Leber.
Ein weiterer, wichtiger Parameter ist das Verhältnis von Omega-6-Fettsäuren zu Omega-3-Fettsäuren im Blut. Erstrebenswert ist ein möglich kleiner Index. Das heißt, dass Omega-6-Fettsäuren vermindert werden sollen zugunsten einer Erhöhung der Zufuhr von Omega-3-Fettsäuren.
Eine ausgewogene Ernährung liefert in der Regel 4 Teile Omega-6-Fettsäuren auf 1 Teil Omega-3-Fettsäuren. Im täglichen Leben jedoch sieht die Nahrungsaufnahme so aus, dass die Aufnahme von Omega-6-Fettsäuren um den Faktor 10- bis 20-mal höher ausfällt, aufgrund des Verzehrs von tierischen Fetten aus Milchprodukten und rotem Fleisch.
Eine Reduktion von diesen Produkten zugunsten von Fisch, Spirulina, Krill Öl würde das optimale Verhältnis von Omega-6-Fettsäuren zu Omega-3-Fettsäuren garantieren. Leider sind aber heute Fisch und Fischöl (und vielleicht auch das Krill Öl) von Schwermetallen so belastet, dass sie den gesamten gesundheitlichen Nutzen dieser Ernährungsform wieder in Frage stellen.
So wie es aussieht, ist Spirulina aus kontrollierten Zuchtanlagen die momentan einzig sichere Quelle für schwermetallfreie Omega-3-Fettsäuren.
Von daher erscheint es mehr als sinnvoll, Produkte oder Präparate mit Omega-3-Fettsäuren für Patienten bereitzuhalten, die an einer Hepatitis oder Autoimmunerkrankung der Leber leiden. Ein Test, der die Ratio von Omega-6-Fettsäuren zu Omega-3-Fettsäuren ermittelt, ist leider verhältnismäßig teuer, schwierig und nur von Speziallabors zu erstellen. So gut und sinnvoll dieser Test für viele Erkrankungen auch sein mag, er ist aufgrund der spezifischen Schwierigkeiten in der Praxis kaum machbar.
Bei einer Lebererkrankung aber gibt er wertvolle Hinweise auf diagnostische und weiterführende therapeutische Aspekte, und sollte eigentlich zum Standardrepertoire der Laboruntersuchungen gehören.
Übrigens: Wenn Sie solche Informationen interessieren, dann fordern Sie unbedingt meinen kostenlosen Praxis-Newsletter „Unabhängig. Natürlich. Klare Kante.“ dazu an: